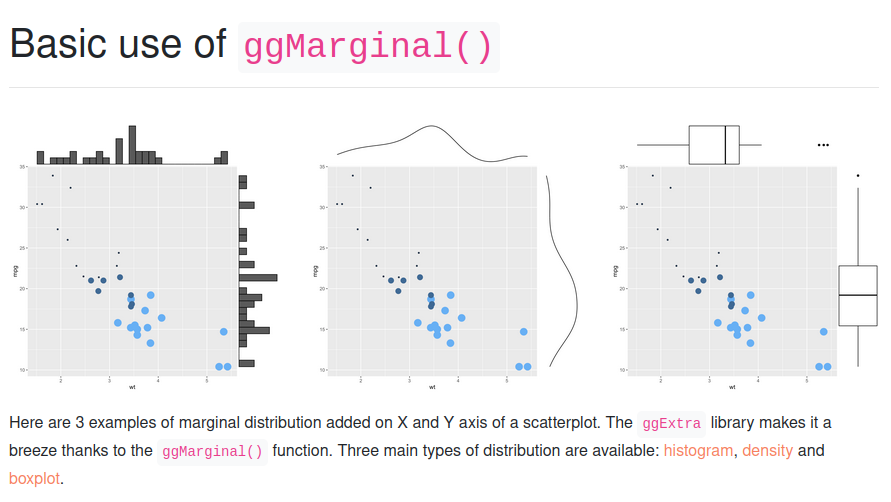Materialsammlung Psychologische Forschungsmethoden
Topic outline
-
Dieser Kurs soll dich bei deinem empirischen Forschungsvorhaben vertieft unterstützen und ist auf die Lehre in den Psychologiestudiengängen an der Universität Kassel abgestimmt. Bei Fragen steht dir die (studentische) Methodenberatung des Fachgebiets Psychologische Forschungsmethoden zur Verfügung. Grundlegende Kenntnisse der Verfahren werden vorausgesetzt, wir geben aber auch wiederholende und ergänzende Literaturhinweise sowie kommentierte Code-Beispiele in R.Hinweise zur Navigation:
- Klick einfach auf die Überschriften unter "Übersicht über die Themen", zu denen du dich informieren willst. Du kannst auch in der Seitenleiste links navigieren.
- Nach Begriffen suchen kannst du, indem du alles ausklappst (rechts oben) und mit Strg + F (Windows) oder cmd + F (Mac) nach Begriffen suchst.
- Öffne Textseiten in neuem Tab über Rechtsklick + Öffnen in neuem Tab, um einfach und ohne Laden wieder zurückzunavigieren.
Wir haben auch eine Checkliste für Empras und Abschlussarbeiten und für die Präregistrierung erstellt.
-
-
-
-
-
↳ Hier erfährst du unter anderem etwas über Confounder, Mediatoren und Collidervariablen.
-
-
-
-
-
-
-
-
Die aktuellsten Versionen von Cheat Sheets findest du außerdem auf der posit-Homepage (ehemals RStudio).
-
-
-
-
-
-
↳ Hier erfährst du etwas zu abhängigen und unabhängigen Faktoren, Faktorstufen, Balanciertheit und der generellen Benennung von ANOVA Designs.
-
-
-
↳ Hier erfährst du etwas zu Voraussetzungen und Störeinflüssen bei t-Tests und ANOVAs und wie du mit deren Verletzung umgehen kannst
-
↳ Hier erfährst du etwas zu Cohens d, (partial) eta squared und generalized eta squared
-
Wann ist eine Alphafehler Korrektur sinnvoll, welche Arten von multiplen Testen gibt es?
-
-
-
-
Wenn du deine ANOVA-Skills komplett auffrischen möchtest, dann findest du hier eine Übersicht über:
- Einfaktorielle Varianzanalyse für unabhängige Stichproben
- Zweifaktorielle Varianzanalysen für unabhängige Stichproben
- ANOVA für abhängige Stichproben
Navigiere mit den kleinen Pfeiltasten! - Einfaktorielle Varianzanalyse für unabhängige Stichproben
-
-
-
-
-
↳ Hier erfährst du etwas zu Multikollinearität und einflussreichen Datenpunkten (z.B. Ausreißer- und Extremwerte)
-
↳ hier Erfährst du etwas darüber wie Messfehler deine Ergebnisse von der Multiplen Regression verzerren können
-
Hier erfährst du etwas über Schrittweise Regression und Best-Subset Selection und Commonality-Analyse
-
-
-
-
-
-
↳ Die Voraussetzungen/Störfaktoren für das Pfadmodell gleichen denen in der linearen Regression (Linearitätsannahme, Unabhängigkeit und Homoskedastizität und Normalverteilung der Residuen), nur dass die korrekte Spezifikation des Modells noch zentraler ist (= keine fehlenden Variablen und Pfade).
-
↳ Hier erfährst du etwas zu Multikollinearität und einflussreichen Datenpunkten (z.B. Ausreißer- und Extremwerte).
-
-
-
-
-
-
-
Hier findest du auch Infos zur R-Fehlermeldung "singular fit".
-
-
-
-
-
-
-
-
Wenn du den Grafik-Code selbst ausprobieren möchtest, kannst du die im Tutorial verwendeten Daten einfach herunterladen und mit load("Beispieldaten.rda") in RStudio einlesen.
-
-
-
Wenn du die Beispiel-Grafiken selbst ausprobieren möchtest, kannst du die Daten einfach herunterladen und den Beispiel-Code in RStudio ausführen.
-
-
-
Die aktuellste Version des Cheat Sheets und weiterführende Informationen findest du außerdem auf der ggplot2-Homepage.
-
Wenn du lieber Grafiken in base R (ohne das Pakage ggplot2) erstellen möchtest, kannst du dir hier verschiedene Tutorials anschauen (beispielsweise für Liniendiagramme, o.a.).
-